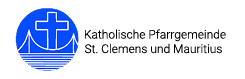Daniel Barenboim ist ein Dirigent und Pianist von internationalem Ruf. Er initiierte in der „Staatsoper Unter den Linden“ ein Gedenkkonzert zum 8. Mai, das auf 3sat auch live übertragen wurde. Am 8. Mai 2020 jährte sich die Kapitulation von Nazi-Deutschland zum 75. Mal. Das Datum markiert das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa und wird begangen als Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus.
Die Situation war gespenstisch, denn der Zuschauerraum war leer. Auf der großen Bühne wartete ein gutes Dutzend Musiker. Dann betrat Daniel Baren- boim mit ernster Miene die Bühne und hielt eine kurze Ansprache an die Zuschauer. Der Künstler betonte, dass die Gesundheit erste Priorität habe, er verstehe, dass über die wirtschaftlichen Konsequenzen gesprochen werde. Aber jetzt müsse auch die dritte Priorität folgen. „Ich höre das Wort Kultur überhaupt nicht, nur, was man wirtschaftlich machen kann für Musiker und andere.“ Das sei wichtig. Aber man dürfe nicht vergessen, dass Musik stets im Raum entstehe. Musiker müssten spielen und das Publikum es live erleben können. Auf seinen Knien, sagte Barenboim, bitte er die Verantwortlichen, „dass sie vorsichtig mit großer Fantasie überlegen, wie wir anfangen können zu spielen.“
Doch Pustekuchen: Ich befürchte, dass noch viel Wasser die Spree, bzw. den Rhein herunterlaufen wird, bis des Maestros Wunsch in Erfüllung geht. Kunst will Öffentlichkeit. Sie will Nähe schaffen zwischen Künstlern und Publikum, aber auch zwischen den Zuhörern untereinander. Jede mittelmäßige Liveaufführung ziehe ich der Produktion aus der Konserve vor. Bei der Konzertankündigung in den Medien entsteht Vorfreude. Zum Ritual gehört der Erwerb von zwei Eintrittskarten. Das ist nicht nur mit Kosten verbunden, manchmal auch mit Glück oder „Vitamin B“. Der Aufführungsort liegt auch nicht gerade um die nächste Ecke. Und wer Pech hat, dem hustet der Nachbar auch noch pausenlos da- zwischen und beeinträchtigt die Freude am Zuhören beträchtlich. Und jedes Mal, wenn die Beleuchtung abgedunkelt wird und das Stimmengewirr im Saal abnimmt, atme ich auf: Es hat sich gelohnt! Nur bei einer Liveaufführung entsteht ein Wir-Gefühl, nur hier entwickelt sich Begeisterung, nur hier bin ich konzentriert dabei – und hoffentlich grätscht kein Handy-Klingelton dazwischen.
Ob Kunst, Sport oder auch Religion, sie sind Formen der Gemeinschaftsbildung. Bei der Kunst sind es die Zuschauer, beim Sport die Fans und bei der Religion die Gläubigen: Sie allein erzeugen Atmosphäre, die sogar zu den Ausführenden hinüber schwappt und sie zur Höchstleistung animiert. Nähe entsteht erst im Zusammenspiel von Ausführenden und Beteiligten, im Mitgehen des Publikums, in der Begeisterungsfähigkeit der Anwesenden, ob im Konzertsaal, im Stadion oder in einer Kirche.
Aus und vorbei? Wer hätte sich noch Weihnachten vorstellen können, dass wenige Monate später eine Maske zur Grundausstattung des öffentlichen Lebens gehört? Maske und Abstand reglementieren das Zusammenkommen der Menschen und halten sie auf Distanz. Überall sind die Hinweisschilder gegenwärtig: „Hygienevorschriften bitte einhalten!“ Es sprengt mein Vorstellungsvermögen: Ballermann verwaist, Sylt gesperrt für Zweitwohnungsbesitzer, Urlauber und Tagestouristen, und der Heilige Vater pilgerte noch Mitte April durch die leergefegten Straßen von Rom. Wie gekommen, so zerronnen. Anfangs gab es noch Nachbarschaftshilfen für Risikogruppen. Sahen Sie vielleicht auch Anzeichen einer neuen Annäherung zwischen den Generationen? Zeigte sich möglicherweise eine Überwindung jener Gefühlskälte ab, die Nähe verhindert und Anonymität fördert?
Das kleine Flämmchen züngelte nicht lange, denn seit Wochen heißt das ersehnte Zauberwort „Lockerungen“. Sie sollen den Weg zur Normalität bahnen. Die Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft überbieten sich geradezu an Lautstärke, Profilierungssucht und Versprechungen und erwecken den Eindruck: Das Schlimmste sei überstanden, der Weg zur verlorenen Normalität stünde wieder offen. Nur noch eine kleine Weile, dann wäre die Pandemie abgehakt und die mit ihr verbundenen Schutzmaß- nahmen Vergangenheit. Und täglich werden Sie heimgesucht von Erfolgsmeldungen, wie reibungslos der Rückweg zum verlassenen Gelobten Land der Normalität verlaufe ...
Schönreden ist immer ein Indiz für Schwäche. Etikettenschwindel hofft auf den „dummen Kunden“, der das Mittelmaß akzeptiert und sich damit zufrieden gibt. Denn bei genauem Hinsehen handelt es sich doch um nichts anderes als Etikettenschwindel, wenn Nähe versprochen, aber immer nur unter Vorbehalt gelebt werden darf. Fußball ja, aber nur als Geisterspiele. Gottesdienste gestattet, aber ohne gemeinsames Singen und Beten. Schule geöffnet, aber nur für Abschlussklassen. Und der Anblick vermummter Gestalten in allen Bereichen des öffentlichen Lebens ist nicht gerade erfrischend. Geradezu ärgerlich ist das Schwadronieren über die Schwächsten der Gesellschaft: Kinder und Senioren. Von der Rückkehr zu einem geregelten Unterricht kann keine Rede sein. Die erzwungene Isolation von betagten oder pflegebedürftigen Menschen ist nach wie vor eine Zerreißprobe für die Nerven der Beteiligten. Senioren, Pflegekräfte und Angehörige sind am Limit. Normalität sieht anders aus.
Die Bestimmung von Nähe und Distanz wird zur Herausforderung schlechthin, der sich jeder täglich zu stellen hat. Es geht um einen Balanceakt, der vor allem viel Fingerspitzengefühl erfordert. Da ist das Verlangen nach Nähe einerseits, das Verantwortungsgefühl vor dem Schutz des Nächsten andererseits; und dann noch die ungewisse Aussicht auf die Dauer dieses Ausnahmezustands. Rückkehr in ein „normales“ Leben: wann und unter welchen Bedingungen? In der Bibel gibt es den Propheten Qohelet. Er ist ein Mann der Skepsis. Auch er steht in der Situation, die Balance zwischen den Gegensätzen täglich neu zu finden. Seine Antwort lautet: Welche Situation ist heute dran? Welche Stunde ist jetzt gekommen? Wie werde ich in den nächsten Minuten gefordert?
„Alles hat seine Stunde und für jedes Vorhaben unter dem Himmel gibt es eine Zeit: eine Zeit zum Gebären und eine Zeit zum Sterben, eine Zeit zum Pflanzen und eine Zeit, die Pflanzen abzuernten, eine Zeit zum Töten und eine Zeit zum Heilen, eine Zeit zum Einreißen und eine Zeit zum Bauen, eine Zeit zum Weinen und eine Zeit zum Lachen, eine Zeit zum Klagen und eine Zeit zum Tanzen, eine Zeit zum Steinewerfen und eine Zeit zum Stei- nesammeln, eine Zeit zum Umarmen und eine Zeit, sich der Umarmung zu enthalten, eine Zeit zum Suchen und eine Zeit zum Verlieren, eine Zeit zum Aufbewahren und eine Zeit zum Wegwerfen, eine Zeit zum Zerreißen und eine Zeit zum Nähen, eine Zeit zum Schweigen und eine Zeit zum Reden, eine Zeit zum Lieben und eine Zeit zum Hassen, eine Zeit für den Krieg und eine Zeit für den Frieden ... Was ist, ist schon längst gewesen, und was sein wird, ist schon lange da, und Gott sucht das Vergangene wieder hervor“ (Qohelet 3,1 – 8.15).
Welche Zeit ist jetzt gekommen? Ist jetzt Nähe wünschenswert? Wird sie jetzt sogar eingefordert? Oder ist jetzt gerade Distanz ein Zeichen von Mitmensch- lichkeit, Respekt und Rücksichtnahme? Schafft jetzt gerade ein Brief – weder Mail noch WhatsApp! – die ersehnte Nähe: handschriftlich und auf dem Postweg zugeschickt? Gerade jetzt Dinge gemeinsam unternehmen, die immer wieder verschoben wurden: einmal zu Fuß um den Laacher See. Warum nicht gerade jetzt den „Sommernachtstraum“ gemeinsam lesen mit verteilten Rollen? Wenn nicht jetzt, wann dann ist die Zeit zum gemeinsamen Musizieren, Fotografie- ren, Aufräumen? Gerade heute kommt vielleicht der Augenblick, wo es mir wie Schuppen von den Augen fällt, wie sehr ich Dich liebe? Gerade jetzt schmilzt jede Distanz, wenn ich erfahre, geliebt zu werden ...
Noch einmal zurück zu Herrn Barenboim. Ich vermisse meinen Stammplatz in der „Staatsoper Unter den Linden“; ich vermisse den Gang zur Kölner Phil- harmonie und den Auftritt „meiner Stars“. Und freue mich gleichzeitig über die geschenkte Nähe: wunderschöne Briefe, beim Spaziergang durch den Stadtwald, Filme schauen ... und darauf hoffen, dass ich allmählich begreife: Welche Zeit ist jetzt gekommen?